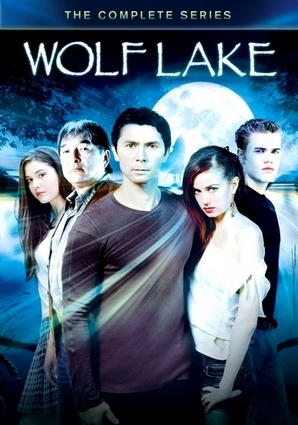Nach „Knights of Badassdom“ hat Joe Lynch mit „Everly“ eine weitere Regiearbeit abgeliefert, die (im Angesicht durchaus verheißungsvoller Gegebenheiten) eigentlich deutlich spaßiger und besser hätte daherkommen müssen als das fertige Ergebnis letztendlich ausgefallen ist. Im Vorliegenden wurden Eigenschaften á la Charakter- und Handlungstiefe einer gradlinig voranschreitenden Minimal-Story (voller Action, derben Gewalttätigkeiten und humoristisch-schrägen Einlagen) konsequent untergeordnet, welche sich zwar relativ kurzweilig entfaltet, regelmäßig jedoch unvorteilhaft „ausgebremst“ wird, u.a. durch wenig überzeugende sentimentale Momente. Während Salma Hayek in der Hauptrolle anständig agiert, vermag der quasi „um sie herum gestrickte“ Film in handwerklicher sowie optischer Hinsicht weitestgehend zufrieden zu stellen: Die begrenzte Location wurde beispielsweise ersprießlich effektiv ins rechte Licht gerückt. Problematisch ist da schon eher Lynch´s Zurückgreifen auf diverse ausgeprägte Klischees – sowohl auf die Plot-Beschaffenheit und Figuren als auch auf die generelle Präsentation des Ganzen bezogen (das Auftreten der asiatischen Gangster, der Umgang mit sowie die Darbietung von Prostituierten, die vordergründig sexy in Szene gesetzte Hayek Schrägstrich Everly, was unter dem „Pseudo-Deckmantel“ von „Female Empowerment“ geschah etc.). Selbstverständlich ist mir bewusst, dass der Streifen im Grunde nichts mehr als ein „kultiges kleines B-Movie“ sein möchte – aber Lynch verfügt einfach weder über das Talent von Branchen-Kollege Tarantino noch über die „Energie“ eines Regisseurs wie Robert Rodriguez, um dieses Ziel in einem wirklich achtbar-umfassenden Maße zu erreichen. Schade.