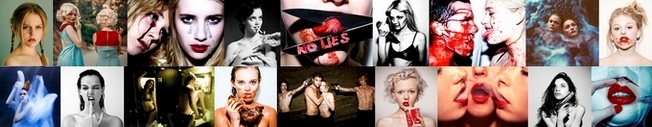Letters from Iwo Jima
 Originaltitel:
Originaltitel: Letters from Iwo Jima
Herstellungsland: USA
Erscheinungsjahr: 2006
Regie: Clint Eastwood
Darsteller: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase, Shido Nakamura, Hiroshi Watanabe, Takumi Bando, Yuki Matsuzaki, Takashi Yamaguchi, Eijiro Ozaki, Nae, Nobumasa Sakagami
Jeder Krieg hat zwei Seiten und Eastwood scheint der Einzige zu sein, der das wirklich begriffen hat. Die Tatsache, dass er selbst mit propagandistischen Kriegsfilmen aufgewachsen ist, die nur Gut und Böse kannten, kennzeichnet ihn als intelligenten, selbst denkenden Menschen aus, denn seinen eigenen Wurzeln stemmt er sich nun entgegen und vervollständigt mit "Letters from Iwo Jima" nun ein einzigartiges Antikriegs-Epos, das als einziges mir bekanntes Werk Vollständigkeit für sich beanspruchen kann. Erst mit dieser zweiten Arbeit, die aus Sicht der Japaner und im Originalton erzählt wird, erreicht der vorangehende "Flags" seine wirkliche Klasse, denn von nun an komplettieren sich beide Filme, nehmen interdisziplinär aufeinander Bezug, kausal handlungstechnisch gesehen wie ideologisch, und endlich setzt es sich zusammen, das im Vorfeld erwartete Meisterwerk.
Denn nun sind es die Amerikaner, die dämonisiert werden: Sass man in "Flags" noch mit den US-Soldaten in den auf Iwo Jima andockenden Schiffen und wurde hinterlistig aus Tunnelgewölben heraus beschossen, stellt sich jene Armada aus US-Kriegsfahrzeugen nun als androhende Gefahr dar, denn man sitzt nun auf der Insel und muss mit ansehen, wie sich das Meer am Horizont mit graumetallenen Flecken deckt.




Die Dialoge sind wohl das Erhellendeste an "Letters", denn sie verraten zum einen die unterschiedlichen Ideologien der Japaner und Amerikaner (alleine der erste gesprochene Satz fühlt sich schon bemerkenswert in die japanische Kultur ein), und doch sind sie alle Menschen mit den gleichen Bedürfnissen, eine Erkenntnis, die auch mancher japanische Soldat im Laufe des Filmes zu realisieren beginnt. Gedreht auf japanisch, gesteht Eastwood den verwöhnten Amerikanern nun nicht einmal eine US-Tonspur zu, denn im Grunde ist die Tonspur ja die gleiche wie in “Flags”, nur dass der Anteil der japanisch sprechenden Charaktere nun umgekehrt proportional zu derjenigen aus dem Vorgänger ist. Die wenigen Worte, die in amerikanisch gewechselt werden (etwa zwischen dem japanischen Offizier und dem amerikanischen Kriegsgefangenen), sind an einer Hand abzuzählen.
So klug diese Entscheidung für das Land auch sein mag, dessen Beteiligung hier verarbeitet ist, so nachvollziehbar ist meiner Meinung nach allerdings auch die Entscheidung, dem deutschen Publikum eine Tonspur in der eigenen Sprache vorzulegen. Indem man nämlich die Japaner in der eigenen Sprache sprechen hört, verstärkt sich das Identifikationspotenzial gegenüber der Option, das Japanische mit deutschen Untertiteln zu verfolgen, erheblich - zumal die Synchronisation (erfreulicherweise ohne nennenswerte bekannte Synchronsprecher, die an der Authentizität genagt hätten) qualitativ relativ gut gelungen ist und vor allem nicht die kulturelle Herkunft unterschlägt. Entsprechende Ausrufe wie “Banzai” bleiben daher auch in der Übersetzung erhalten.
Rückblenden veredeln den menschlichen Faktor und verleihen der Geschichte äußerst komplexe Zusammenhänge, die es sehr schwer machen, irgendwelche Erklärungen zu finden für das immer wiederkehrende Muster. Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Völkern kennt man, seit Geschichtsschreibung betrieben wird. Eastwood maßt sich nun nicht an, ein Rezept (sprich: eine Moral) zu entdecken, die in der Zukunft gegen Kriege helfen könnte; er verarbeitet lediglich Historisches und deckt auf, wie viele Graustufen existieren, die man bisher noch nicht entdeckt hat. Soziale und gesellschaftliche Normen stehen auf dem Prüfstand, wenn der japanische General in einer Rückblende bei einem US-Prominenten zum Essen eingeladen ist und von der Frau des Amerikaners die spekulative Hypothese in den Raum gestellt wird, dass Japan und Amerika gegeneinander im Krieg stünden und wie der Gast daraufhin handeln würde. Die Antwort ist im Gegensatz zur folgenden Realität diplomatischer Natur.
Die Rangordnung der japanischen Armee verleiht “Letters” seinen Spannungsbogen, der dieses zweite Werk auch formell seinen Vorgänger übertrumpfen lässt. Wenn Männer unterschiedlicher Grade aufeinander stoßen und ihre Standpunkte nicht immer übereinstimmen, ergeben sich Spannungsspitzen, die zeitweise vom ungeliebten Gegner ablenken und in tiefliegende Auseinandersetzungen mit sich selbst ausarten. Die mit Ehrgefühl verbundene Selbsttötungsszene, der emotionale Höhepunkt der Geschichte, wirkt eigentlich ehr- und sinnlos und stellt so etwas wie die "unsichtbare Hand des Krieges" dar, die Manifestation einer unsichtbaren, teuflischen Gottheit, die nur durch das Handeln der Menschen ihre Existenz einnimmt. Ein Handeln, das aus guten Absichten resultieren kann, aber stets im Bösen endet. Ein Handeln, das in diesem speziellen Fall in Japan gar als Tradition durchgehen kann; das “Seppuku” kennt man hier bereits seit dem 12. Jahrhundert. Und das ist das eigentlich Schockierende in diesen Momenten, die Selbstverständlichkeit, mit der eine Kultur dem kollektiven Selbstmord einen positiven Wert wie “Ehre” auferlegt - unfassbar für unsereins.




Darüber vergisst man auch, dass “Letters” irgendwo im Nichts zu schweben scheint, sich weitestgehend von zeitlichen Lokalisierungen fernhält und den Fokus auf kleinere Soldatengruppen richtet, die keine Vorstellungen davon zulassen, wie der Kampf um Iwo Jima aus der Makroperspektive ausgesehen haben muss. Der Blickwinkel ist klar mikroperspektivisch und nähert sich von dort aus der angestrebten Wahrheit, und vielleicht schaut jene Wahrheit genau deswegen ein wenig anders aus als diejenige, die man als Ergebnis einer makroperspektivischen Betrachtung gewinnen würde.
“Letters” ist gegenüber "Flags" der in sich geschlossenere und stärkere Film, der außerdem über die besseren Schauspielleistungen verfügt (allen voran Ken Watanabe spielt hervorragend). Allerdings hat er auch den wichtigen Vorteil, erst an zweiter Stelle zu kommen und sich bereits auf das Komplementäre beziehen zu können. Denn rückblickend reicht "Flags" wieder recht nahe an "Letters" heran.
Insgesamt liefert Clint Eastwood den Beweis dafür, dass das Ganze oftmals weit mehr als die Summe seiner Teile ist. "Flags of our Fathers" und "Letters from Iwo Jima" sind für sich betrachtet zweifellos gute Antikriegsfilme, aber nur gemeinsam ein Meisterwerk. Ein erschreckender Parallelismus auf den Krieg, denn von ihrer funktionalen Seite aus betrachtet ist die Armee ohne ihren Feind rein gar nichts. Doch Armeen bestehen aus Menschen und Menschen sind weit mehr als Soldaten. Zum Beispiel Eltern, Kinder, Ehepartner. Eine Randnotiz, in “Flags” und “Letters” versteckt in Subplots. Eastwoods Botschaft (sofern man das hieraus zu ziehende Substrat “Botschaft” nennen darf bzw. will) ist es, dass diese Subplots es eigentlich verdient hätten, die Haupthandlung zu sein.
Flags of Our Fathers:  Letters from Iwo Jima:
Letters from Iwo Jima:  Das Gesamtwerk:
Das Gesamtwerk: 
DVD kommt von Warner im Steelbook mit beiden Filmen und einer Bonusdisc zu "Flags". Frei ab 12 bzw. 16, beide uncut. Review zur Scheibe gibts
hier.
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
freeman meint:
Mit Letters from Iwo Jima bringt Clint Eastwood heuer sein ehrgeiziges Projekt um die Bebilderung der Schlacht um die strategisch wertvolle japanische Insel Iwo Jima zu einem hervorragenden Ende. Erzählte das komplementäre Werk Flags of Our Fathers die Ereignisse um die Schlacht aus Sicht der Amerikaner, die gegen einen gesichtslosen, eins mit den Bergen der Insel gewordenen und nahezu dämonischen Gegner ankämpften, verleiht Letters from Iwo Jima nun den japanischen Kombattanten ein nur zu menschliches Gesicht. Unter anderem das von General Kuribayashi. Ein umsichtiger, schlauer und gewitzter Feldherr, der bei seinen einfachen Untergebenen schnell begeisterte Anhänger findet, bei seinen ranghohen Untergegebenen dagegen häufiger aneckt. Denn Kuribayashi genoss eine westliche Militärausbildung und ist infolgedessen immer darum bemüht, die verkrusteten Traditionen der japanischen Kriegsmaschinerie aufzubrechen. Dies entpuppt sich schnell als sinnloses Ankämpfen gegen Windmühlen, was verheerende Folgen für die Schlacht haben wird. Nur seinem strategischen Geschick und seiner Idee, in den Bergen der Insel weitschweifige Tunnelsysteme anzulegen, von wo aus man an jedem Ort der Insel zuschlagen konnte und immer einen veritablen Schutz in der Hinterhand hatte, wird man es verdanken, dass die Japaner die Insel in einem vollkommen aussichtslosen Kampf überraschend lange halten können. Kuribayashis Wege kreuzen sich im Zuge der Ereignisse häufiger mit dem einfachen Bäcker Saigo, dem er dreimal das Leben retten wird. Saigo wurde eher widerwillig zum Dienst für Kaiser und Mutterland verpflichtet und hinterließ unfreiwillig seine hochschwangere Frau ihrem Schicksal. Saigo seinerseits wird einen Mann namens Shimizu kennen lernen. Ein Mitglied der japanischen Geheimpolizei, der wegen Befehlsverweigerung seine Stelle verloren hat und in der Hölle von Iwo Jima schnell an seine Grenzen geführt wird. Kaum einer dieser Protagonisten und nur wenige ihrer Kameraden werden die Schlacht überleben ...

Grund dafür sind nicht einmal die verlustreichen Scharmützel. Vielmehr werden unglaublich viele Soldaten ihr Leben überkommenen Ehrenkodizes aus alten Samuraizeiten opfern. Dieser glorifiziert den Tod nach einer Niederlage als glorreiche Pflicht. Demnach lernt die japanische Armee nicht aus ihren Niederlagen, vielmehr richten sich die Besiegten selbst. Ein Akt, der beim Betrachter unglaubliche Beklemmung auslöst und Szenen generiert, die an Intensität kaum noch zu überbieten sind. In der eindrücklichsten und grausamsten Sequenz richtet sich eine besiegte Einheit in einem Tunnelsystem selbst, indem sie Handgranaten, nur abgeschirmt durch ihre Hände, in Herzhöhe gegen den eigenen Körper pressen. Was übrig bleibt ist kaum mehr als ein Haufen Fleisch. Diese Szene sitzt wahrlich wie ein Fausthieb in die Magengrube, prallen hier doch vor allem kulturell vollkommen verschiedene Ansichten aufeinander. In unseren Breiten wird man nämlich in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit dieser Handlungsweise nur ungläubig mit dem Kopf schütteln. Ein Fakt, der noch mehr dafür sorgt, dass diese unglaubliche Sequenz auch noch lange nach dem Film nachhallt und sich fast unvergesslich einbrennt. Genauso schockierend wie diese Selbstmordaffinität der Soldaten sind die Zustände, die in Letters from Iwo Jima beschrieben werden. Die japanischen Soldaten siechten mehr tot als lebendig in den Tunnelsystemen vor sich dahin. Es gab kaum Nahrungsmittel, kein sauberes Wasser, man war chronisch unterbesetzt, das Kaiserreich verwehrte aufgrund verlustreicher Kämpfe an anderen Kriegsschauplätzen jegliche Form von Nachschub, das tagelange Dauerbombardement zerrte an den Nerven und schon nach zwei Tagen herrschte akute Munitionsarmut. Wenn sich dann auch noch die eigenen Offiziere gegen Kuribayashi stellen und nach eigenem Gutdünken handeln, fragt man sich schon, wie die Japaner dieses Eiland so lange halten konnten. Auf jeden Fall wird so der heroische Sieg der Amerikaner, der ja schon in Flags entzaubert wurde, noch einmal richtig extrem geerdet. Denn egal, wie der Sieg im Nachhinein mittels des Flaggenhissungsfotos auch glorifiziert wurde, wirklich heroisch war an der Eroberung von Iwo Jima nichts.
Clint Eastwood erzählt Letters im Gegensatz zu Flags ungemein geradlinig und unterbricht nur mit wenigen Rückblenden in das Leben seiner japanischen Protagonisten diese narrative Grundstruktur. Zudem lässt sich Eastwood sehr viel Zeit für die Verortung seiner Protagonisten, was in der letzten Stunde für ein hohes Involvement des Zuschauers sorgt, da hier Menschen in den Opfertod rennen, die einem wahrlich ans Herz gewachsen sind. Wenn dann die Schlacht um Iwo Jima endgültig entbrennt, legt Eastwood den Fokus gar nicht so sehr auf die Kriegshandlungen. Viel mehr scheint ihn die Dynamik in den Tunneln und die psychologischen Kämpfe der japanischen Protagonisten in den dunklen Gängen zu interessieren. Diese tragen nämlich einen offenen Kampf der Tradition gegen die Moderne aus. Sie hinterfragen überkommene Moralvorstellungen und sie stellen schnell fest, dass der von der Propaganda dämonisierte Feind nicht anders ist, als sie selbst. Menschen mit Wünschen, Zielen, Hoffnungen und vor allem mit Familien, denen sie, genauso wie die Japaner, entrissen wurden, um in einem Krieg zu kämpfen, dessen Sinn sie gar nicht richtig verstehen. Dennoch entwirft Eastwood auch einige eindrückliche Kriegsszenerien. So gigantische Totalen von der engmaschigen Bombardierung der scheinbar vollkommen schwarzen Insel, der Landung der Amerikaner auf Iwo Jima und der anrückenden amerikanischen Flottenverbände. Diese Szenen, die vor allem die technische und zahlenmäßige Übermacht der Amerikaner demonstrieren, sind hervorragend getrickst und verursachen den einen oder anderen Gänsehautmoment. In den Kampfszenen ist Eastwood dann auf Augenhöhe mit seinen Protagonisten und geht mitten rein ins Scharmützel. Folgerichtig darf die Kamera umherstolpern und orientierungslos umherschwenken, was für eine hohe Authentizität sorgt. Optisch bleibt Eastwood unglaublich gedeckt in der Wahl der Farben. Zunächst dominieren monochrom grünstichige Bilder. Diese gehen über in einen sepiafarbenen Abschnitt und münden in monochrom rotstichigen Momenten. In der eigentlichen Schlacht zieht Eastwood sämtliche Farbe aus dem Film und verleiht ihm so die Anmutung eines Schwarz-Weißfilmes. Hier arbeitet er mit harten Kontrasten, viel Dunkelheit und setzt nur wenige farbige Akzente mit Signalfarben wie Rot (Blut) oder Orange (das komplette Farbspektrum, das bei Explosionen und Flammenwerfern im Allgemeinen auftreten kann). Das untermalen Kyle Eastwood und Michael Stevens mit einem extrem reduzierten, sehr feingliedrigen, niemals - auch in den Schlachten nicht - aufbrausenden Soundtrack, der ein sehr schönes Thema transportiert, abseits dieses Themas aber nicht hundertprozentig zu überzeugen weiß.

Dagegen wissen die Darsteller allesamt zu überzeugen. Dabei hat es mir nach Last Samurai und der Geisha erneut Ken Watanabe als General Kuribayashi angetan, der hier mit unglaublicher Leinwandpräsenz einen charismatischen General verkörpert, dem wohl jeder ohne groß zu zögern sein Leben in die Hände legen würde. Watanabe ist meines Erachtens ein ähnlicher Charismatiker wie es heute nur noch Chow Yun Fat oder Harrison Ford sind. Im Gegensatz zu jenen, hat er aber meines Erachtens eine deutlich größere schauspielerische Bandbreite, die er in Letters in vollem Umfang einbringen kann. Toll seine verschmitzt humorigen Kommentare in Richtung seiner verknöcherten Offiziere. Schön sein legerer Umgang mit seinen einfachen Untergegeben. Mutig sein Ankämpfen gegen die Traditionen und grandios die Momente, in denen er seiner Wut in kurzen Ausbrüchen freien Lauf lässt. Dieser grandiosen Performance stehen die restlichen Darsteller in Nichts nach. Eastwood beweist sich dabei erneut als großer Schauspielerregisseur, dem nicht viel an großen Gesten und überkandidelter Mimik liegt. Er verweilt lieber in den Gesichtern seiner Darsteller und liest daraus alles ab, was er transportieren möchte. In Letters reichen kurze Nahaufnahmen der Schauspieler, um ganze Geschichten von all dem Stress, der Anspannung, der Angst und der Wut zu erzählen, die die Figuren beherrschen.
Wenn man Iwo Jima Vorwürfe machen will, muss man konstatieren, dass die Konzentration auf Kuribayashi, Saigo und Shimizu ein wenig dazu führt, dass man das Gefühl hat, hier würde nur eine Handvoll Japaner gegen eine riesige Übermacht ankämpfen. Diesen Eindruck federt Eastwood selbst nie ab! Es gibt niemals Kommentare zu Truppenstärken, Verlustangaben usw.. Damit wird das Massengrab Iwo Jima (laut historischen Überlieferungen ließen hier knapp 20 000 Japaner ihr Leben) meines Erachtens ein wenig verklärt und mutet fast schon an wie die Geschichte um die 300 Spartaner, die sich an den Thermophylen einer riesigen Perserübermacht stellten. Ein weiterer Punkt ist das vollkommene Fehlen von Zeitangaben. Es wäre schön gewesen, zu erfahren, wie lange die Kämpfe andauerten (meines Wissens fast 40 Tage) und wie lange die Entbehrungen der Japaner eben insgesamt vorhielten, da sie ja schon vor den Kämpfen unter extremen Nahrungsmittelengpässen zu leiden hatten. Als Zuschauer verliert man allerdings vollkommen den zeitlichen Bezug, zumal hier im Dialog immer einmal Sprünge von mehreren Monaten erwähnt werden, diese sich aber nicht wirklich manifestieren - weder klimatisch, noch optisch. In der letzten Stunde sieht man dann zwar am körperlichen Verfall der Soldaten, dass einige Zeit ins Land gezogen ist, etwas spezifischere Zeitangaben wären aber sehr schön gewesen. Ein weiterer Punkt geht an die Verleiher und hat mich schon in Apocalypto gestört: Die Untertitel! Ich habe nichts gegen Untertitel im Kino, allerdings sollte man sich über deren Erscheinungsform schon ein wenig Gedanken machen! Gerade bei einem farblich tristen Streifen wie Letters ist es verheerend, wenn weiße Untertitel gewählt werden und diese sogar relativ häufig vor ebenfalls weiß anmutenden Hintergründen erscheinen. So gehen hier doch einige Dialoge in irgendwelchen "weißen Löchern" unter.

Schlussendlich ist Letters from Iwo Jima eine wütende Anklage gegen jegliche Kriegstreiberei, die berührt, nachdenklich macht und Szenen aufbietet, die noch lange nachwirken. Im Zuge des gesamten Projektes um die Schlacht von Iwo Jima hätte ich es allerdings lieber gesehen, wenn Letters von einem japanischen Regisseur inszeniert wurden wäre, einfach, weil hier die japanische Sicht der Ereignisse eben durch die Augen eines westliches Regisseurs transportiert werden. Die Gefahr ist meines Erachtens, dass wir letztendlich nur eine idealisierte (siehe meinen Kritikpunkt zu der starken Fokussierung auf die Hauptfiguren) und an die Mainstreamkonventionen angepasste (und sei es nur in den kleinsten Einzelheiten) amerikanisierte Sicht der Ereignisse zu sehen bekommen. Da ich allerdings nicht in der Lage bin, einzuschätzen, inwiefern hier eventuell Verfälschungen stattgefunden haben, bleibt mir nach Sichtung von Letters nur folgende Wertung ...

In diesem Sinne:
freeman