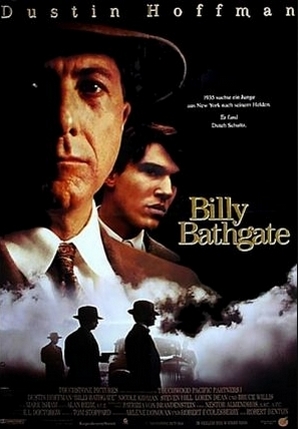Mit „the Purge: Anarchy“ (2014) hat Regisseur und Drehbuchautor James DeMonaco ein Action-orientiertes „Companion Piece” zu seinem 2013er „Home Invasion“-Vorgängerwerk erschaffen, welches das dargelegte (übergeordnete) Szenario Schrägstrich Konzept des ersten Films (willkommener- bzw. dankenswerterweise) erweitert und dabei seine Roger-Corman-artigen „B-Movie-Exploitation-Wurzeln“ (ähnlich wie etwa „Death Race“) ganz ungeniert zur Schau trägt. Der Überlebenskampf der ins Visier gerückten Protagonisten wurde brutal und gritty in Szene gesetzt, die Dialogqualität bewegt sich zumindest innerhalb des Genre-Durchschnitts, das Tempo ist ordentlich und die verschiedenen Set-Pieces kommen erfreulich abwechslungsreich konzipiert und arrangiert daher. In der Hauptrolle überzeugt „Badass“ Frank Grillo und empfiehlt sich einmal mehr für größere (und gern auch forderndere) Rollen in Hollywood´s „Traumfabrik“ – während seine Co-Stars hier dagegen vor allem aufgrund ihrer recht schlicht und unaufregend gestrickten Parts (leider) weder einen bleibenden noch sonst irgendwie lobenswerten Eindruck hinterlassen können. Ergänzt um oberflächlich ausgearbeitete bzw. dargereichte politische Statements, Kritikansätze und provokante Themengebiete (unter ihnen Klassenkonflikte, Regierungsverschwörungen, radikal-revolutionäre Bewegungen sowie das uramerikanische Verhältnis zu Waffen) fügt sich das Gebotene „unterm Strich“ zu einem zwar unebenen und fern von makellosen, nichtsdestotrotz unterhaltsamen Streifen zusammen, dessen für 2016 angekündigter Nachfolger hoffentlich weitere Facetten und Hintergründe des „Purge-Konstrukts“ preisgibt…