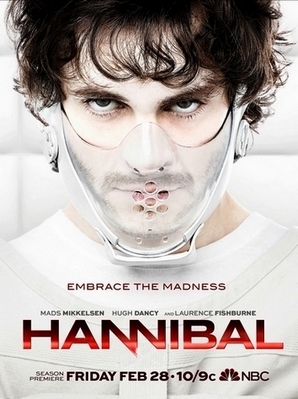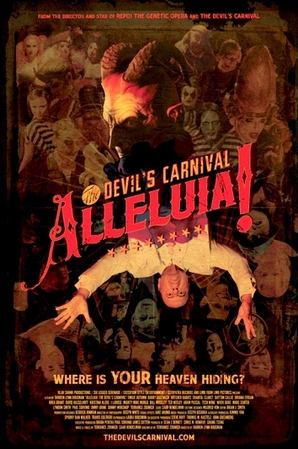Bei „
Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) haben wir es mit einem solide unterhaltsamen Blockbuster zutun, der den hohen Erwartungen leider jedoch nicht ganz gerecht zu werden vermag. Im Gegensatz zu dem überwiegend „lockeren Ton“ der meisten „Marvel“-Verfilmungen, die den Markt in letzter Zeit ja geradezu überschwemmt haben, ist eben jener hier fast durchweg „grimmig, düster und ernst“. Bei einigen Zuschauern kommt das offenbar nicht so gut an – mir persönlich wusste dieser Stil aber durchaus zuzusagen. Das Hauptproblem des Streifens ist es jedoch, dass schlichtweg zu viele Inhalte in die Geschichte mit eingewoben wurden – weitergeführte Plot-Stränge, ergänzende Backgroundinfos, neue Charaktere, die sich aktuell entfaltende Haupthandlung etc. pp. – was zu merklichen Oberflächlich- und Holprigkeiten auf diesem Gebiet geführt hat. Ein längerer „Director´s Cut“ könnte da durchaus noch ein wenig reißen – doch generell krankt die vorliegende Kinofassung daran nunmal am stärksten. In diesem Kontext ist allerdings zu erwähnen, dass selbst jetzt schon einige Momente eher überflüssiger Natur sind – allen voran eine spezielle Sequenz mit Kevin Costner, die zwar etwas „Emotionalität“ ins Spiel bringt, im Grunde aber nichts Wirkliches beisteuert...
Ben Affleck´s Darbietung des ikonischen „Dark Knights“ sehe ich als rundum gelungen an, Henry Cavill schließt mit seiner Performance nahtlos an „Man of Steel“ an und Jesse Eisenberg injiziert dem Geschehen mit seinen Auftritten als Lex Luthor jeweils willkommene „Lebhaftigkeit“: Gott sei Dank hat man sich dagegen entschieden, den Part in der gewohnten „08/15-Form“ anzulegen, wie wir ihn inzwischen ja bereits zu genüge kennen. Währenddessen haben so einige gestandene Akteure (unter ihnen Amy Adams, Holly Hunter und Jeremy Irons) in diversen Nebenrollen leider nur „begrenzen Raum“ zugestanden erhalten – wohingegen zumindest die Einführung von „Wonder Woman“ umfassend gelungen ist: Ihr Eingreifen in die Action ist ein feines Highlight, Gal Gadot verkörpert sie prima und die Vorfreunde auf ihr anstehendes Solo-Abenteuer wurde weiter entfacht. Zack Snyder´s Inszenierung ist gewohnt „wuchtig“ und optisch ansprechend – setzt aber keinerlei „neue Maßstäbe“ oder irgendetwas in der Art. Der Einstieg, im Rahmen dessen Bruce Wayne durch die Straßenschluchten seiner im Chaos versinkenden Heimat-Metropole hetzt, während Superman und Zod sich bekämpfen, bleibt innerhalb der restlichen Laufzeit übrigens unübertroffen. Grundsätzlich ist indes zu erwähnen, dass mir Nolan´s „realistischere“ Herangehensweise besser gefiel als diese erneut nun wieder „Comic-hafter“ daherkommende…
Kurzum: „BvS“ ist durchaus ansehbar – bloß hätte man ihn sich schon ein Stück weit besser gewünscht. Primär mangelt es ihm an „Seele“ sowie an „Ruhe“ bei der Aufarbeitung seiner Inhalte (sowohl auf seine Charaktere als auch auf bestimmte Kernaspekte der Story bezogen). Die entsprechende Verantwortung dafür – und das verkennen viele derzeit gerade scheinbar – ist nicht unbedingt „zentral“ bei Regisseur Snyder zu verorten, sondern eher bei den beiden Drehbuchautoren David S. Goyer und Chris Terrio…