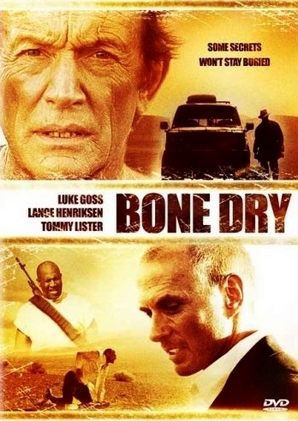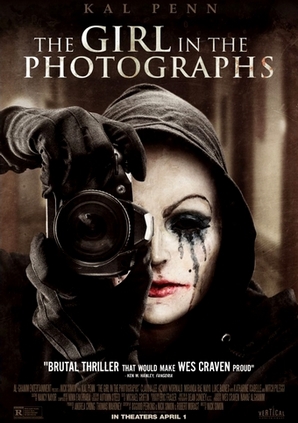Im Gegensatz zu „CGI-Fantasy-Action“ á la „Fast&Furious 7“ erfreut einen „Need for Speed“ – Scott Waugh´s auf der gleichnamigen Videospiel-Reihe basierender Film aus dem Jahr 2014 – mit fast ausschließlich „handgemachten“, sehenswert arrangierten Stunts und Schäden (bloß irgendwie ausgerechnet bei der finalen Explosion nicht). Story-technisch entpuppt das Ganze jedoch (man kann sagen: wie im Grunde vorausgeahnt) als eine ziemliche „Null-Nummer“ und dient eigentlich nur dazu, die Zeit zwischen den verschiedenen „Rasereien“ zu überbrücken – welche dann aber immerhin jeweils für anständige Unterhaltung sorgen und nur wenige arg „haarsträubend dümmliche Momente“ aufweisen (wie z.B. das Auftauchen zweier Betonmischer oder ein Cop, der das Rennen ausgerechnet dadurch aufzuhalten versucht, indem er seinen Wagen einfach mal in den heranbrausenden „Pulk“ hineinfahren lässt)...
Leider ist der Verlauf mit rund 130 Minuten deutlich zu lang geraten, mangelt es des Öfteren an „Logik“ (keine Zeugen am Anfang, Tablet-Zugang im Militär-Knast etc.), präsentiert sich Hauptdarsteller Aaron Paul nicht besser als „zweckdienlich“ (und das im gewohnten „Breaking Bad“-Modus), bleibt „Baddie“ Dominic Cooper durchweg blass und geht einem Michael Keaton im Rahmen seines (angrenzend komplett überflüssig-entbehrlichen) Auftritts zunehmend auf den Senkel mit dem vielen dümmlichen Gelaber seiner Figur. Schauspielerisch (sowie von der „Sympathievergabe“ her) schlägt sich Imogen Poots unterdessen klar am besten – und das trotz des auffallend schwachen Materials, welches ihr das Drehbuch vorgesetzt hat. Kurzum: „Gut“ sieht auf jeden Fall anders aus – bei echtem Interesse an Veröffentlichungen dieser Art kann man sich den Streifen aber durchaus mal vorknöpfen...
tendenziell eher knappe